Selbstverständnis
(Überarbeite Fassung des auf der Mitgliederversammlung am 8.2.2001 vorgelegten Entwurfes)
Im Rahmen des Jahrestreffens des Netzwerkes Medienethik am 8. und 9. Februar 2001 hat sich die Fachgruppe “Kommunikations- und Medienethik” der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft gegründet. Die Fachgruppe ist aus der engen Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) und dem Netzwerk Medienethik hervorgegangen.
Das Netzwerk Medienethik ist ein interdisziplinäres Gesprächsforum zu ethischen Fragen im Medienbereich mit einer breiten disziplinen- und professionsübergreifenden Ausrichtung. Die förmliche Einrichtung einer Fachgruppe “Kommunikations- und Medienethik” soll dazu dienen, diese Arbeit in Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten und durch die Zusammenführung der Ressourcen dieser beiden Körperschaften Synergieeffekte zu entfalten.
1. Allgemeine Ziele der Fachgruppe
Die Fachgruppe versteht sich als Forum für den wissenschaftlichen Austausch und die Auseinandersetzung über aktuelle und grundlegende kommunikations- und medienethische Themen. Darüber hinaus soll der einschlägig interessierte kommunikations- und medienwissenschaftliche Nachwuchs gefördert und das Anliegen der Kommunikations- und Medienethik verstärkt in die Gesellschaft getragen werden.
Aufgabe der Fachgruppe “Kommunikations- und Medienethik” ist es, die Auseinandersetzung über theoretisch-wissenschaftliche und praktisch-anwendungsbezogene Aspekte der Ethik innerhalb der deutschsprachigen Kommunikations-, Publizistik- und Medienwissenschaft zu intensivieren. Die Fachgruppe versteht sich als eine quer zu den anderen Fachgruppen der DGPuK liegende akademische Diskussionsplattform, die als Forum für Wissenschaftler und Praktiker dienen soll.
2. Inhaltliche Gegenstände der Fachgruppe
Kommunikations- und Medienethik umfaßt erstens die traditionellen Bereiche der journalistischen Berufsethik, der Ethik der Massenkommunikation und der Ethik von Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations, sowie der Publikumsethik. Hinzu kommen die Ethik der organisationellen und interpersonalen Kommunikation, wie auch des Medienmanagements. Allgemein gesehen geht es hier zum einen um die Verbesserung und Erweiterung professionsspezifischer Ethikleitlinien, die ethisch sensibilisierte Ausbildung und Qualitätssicherung in den Medien- und Kommunikationsberufen, und die Integration ethischer Standards auf der Ebene der Medien- und Kommunikationsunternehmen und Medienselbstkontrolle. Zum anderen betrifft es Fragen der Anregung und Verstärkung der öffentlichen Auseinandersetzung um medienpolitische, medienrechtliche und medienethische Fragen und der Förderung eines kritischen Medienjournalismus. Darüber hinaus sind hier Fragen interpersonalen und organisationellen Kommunikation, der Kommunikations- und Medienerziehung, der Medienkompetenz und der Publikumsverantwortung zu thematisieren.
Zweitens bezieht sich die Kommunikations- und Medienethik auf das wachsende Feld der Neuen Medien, dort vor allem der Internetethik, aber auch der Informations- und Computerethik. Hier geht es um Fragen wie die sozialen Folgen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK), der Entwicklung der Informationsgesellschaft und der vernetzten Weltgesellschaft. Es geht aber auch um ethisch dringliche Einzelaspekte, wie z.B. das sich durch IuK verändernde Verhältnis von privat und öffentlich, Datenschutz und Zensur, Informations- und Kommunikationsfreiheit, sowie Zugang zu und kompetenter Umgang mit Neuen Medien. Die Ethik der interpersonalen Kommunikation ist unter den Bedingungen vernetzter digitaler Kommunikation ebenso zu überdenken wie die computergestützte Organisationskommunikation. Darüber hinaus geht es auch hier um die Förderung der öffentlichen Auseinandersetzung über medienpolitische, medienrechtliche und medienethische Aspekte der Neuen Medien.
Drittens beschäftigt sich die Kommunikations- und Medienethik mit theoretischen und systematischen Grundsatzfragen. Zum einen geht es um die Auseinandersetzung mit theoretisch-philosophischen Begündungs- und Anwendungsstrategien und ihrer medienethischen Spezifik. Zum anderen sind hier einzelne Ansätze der Kommunikations- und Medienethik (z.B. Diskursethik, Individualethik, Verantwortungsethik, systemische Ethik etc.) zu diskutieren, weiterzuführen und mit anderen angewandten Ethiken zu verknüpfen. Drittens geht es um die Entwicklung von Konzepten und Inhalten für die medienethische Aus- und Weiterbildung in Universitäten und anderen Bildungsinstitutionen. Die Fachgruppe ist sehr daran interessiert, daß Kommunikations- und Medienethik in der bildungspolitischen Diskussion eine zentrale Rolle spielen.
3. Spezifische Aufgaben der Fachgruppe
Die Fachgruppe steht zunächst vor der Aufgabe, die wissenschaftlich-theoretischen und berufspraktischen Ansätze und Sichtweisen zu integrieren. Daneben geht es um die Formulierung und Entwicklung zentraler Forschungsfragen aus kommunikations- und medienwissenschaftlicher Perspektive, um die Bündelung und Verknüpfung existierender medienethischer Forschungsprojekte, und um die Planung und Unterstützung der Forschung im Bereich der theoretischen und angewandten Kommunikations- und Medienethik. Dabei ist die Förderung des kommunikations- und medienethischen Nachwuchses eine zentrale Aufgabe der Fachgruppe.
Kommunikations- und medienethische Aspekte sind nicht nur in den thematisch differenzierten Fachgruppen und Schwerpunkten der DGPuK zu finden, sondern auch in vielen anderen sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Deshalb ist eine Zusammenarbeit der Fachgruppe “Kommunikations- und Medienethik” mit den anderen Fachgruppen der DGPuK, aber auch mit Fachverbänden verschiedener Disziplinen und Bereiche besonders wichtig (z.B. mit dem Internationalen Zentrum für Informationsethik [ICIE] etc.).
Die Arbeit der Fachgruppe zielt darauf ab, die Kommunikations- und Medienethik in der universitären und professionellen Ausbildung zu verstärken und curricular zu verankern. Vor allem an den kommunikations- und medienwissenschaftlichen Instituten der Universitäten sollte für eine möglichst breite ethische Ausbildung gesorgt werden. Die Fachgruppe setzt sich für dafür ein, daß dies nicht nebenbei geschieht, sondern eine entsprechende Infrastruktur (z.B. Professuren für Kommunikations- und Medienethik) eingerichtet und spezifische Lehrpläne und Konzepte erarbeitet werden.
4. Verhältnis der Fachgruppe zum Netzwerk Medienethik
Die Fachgruppe versteht sich als Teil des Netzwerkes Medienethik. Die breite Ausrichtung des Netzwerkes kommt den Interessen der Fachgruppe entgegen, da dies eine Öffnung des akademischen Diskurses in Richtung Praxis ermöglicht. Gleichzeitig wird eine verstärkte wissenschaftliche Beschäftigung mit Kommunikations- und Medienethik auch für das Netzwerk von Vorteil sein. Deshalb sollen die Treffen der Fachgruppe auch in Zukunft gemeinsam mit den Jahrestreffen des Netzwerkes und in enger Zusammenarbeit mit diesem veranstaltet werden.
Fachgruppensprecher/in und Stellvertreter/in sollen zugleich Mitglieder im Beirat des Netzwerkes Medienethik sein, um die enge Zusammenarbeit zwischen Netzwerk und Fachgruppe zu garantieren. Die Mitglieder des Netzwerkes Medienethik können, wenn sie nicht zugleich Mitglied in der DGPuK sind, assoziierte Mitglieder der Fachgruppe werden. Als solche haben sie kein Stimmrecht, wohl aber das Recht zur Mitsprache bei den Mitgliederversammlungen der Fachgruppe. Eine assoziierte Mitgliedschaft kann nach § 3.3 der Fachgruppenordung formlos bei der Fachgruppenleitung beantragt werden.
5. Kommunikation und Publikationen der Fachgruppe
Die fachgruppeninterne Kommunikation soll in erster Linie über einen Email-Verteiler (Listserv) geregelt werden, der von einem dafür bestimmten Mitglied eingerichtet und verwaltet wird. Diese Mailing List soll nicht nur der Information, sondern auch der Diskussion dienen. Daneben sollen die jährlichen Treffen der Fachgruppe auch zur fachinternen Kommunikation über die kommunikations- und medienethische Lehre und Forschung genutzt werden. Zusätzlich soll im Rahmen des DGPuK-Website ein eigenes Webangebot der Fachgruppe erarbeitet werden, das mit dem Angebot des Netzwerkes Medienethik verlinkt wird. Weitere webbasierte Angebote (Artikel, Datenbankzugänge, Forschungsprojekte, Institutionen der Medienethik, etc.) sollen in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk entwickelt werden.
Die Ergebnisse des gemeinsamen Jahrestreffens von Fachgruppe und Netzwerk Medienethik sollen in Zukunft möglichst in Form eines Jahrbuches für Medienethik in gemeinsamer Herausgeberschaft veröffentlicht werden. Die Fachgruppe bemüht sich um entsprechende finanzielle Zuschüsse aus der DGPuK für eine solche Publikationsreihe. Es ist darüber hinaus auch angestrebt, Einzelveröffentlichungen der Fachgruppenmitglieder zu fördern. Dies gilt in besonderer Weise für den wissenschaftlichen Nachwuchs.
6. Änderungen und Ergänzungen des Selbstverständnisses der Fachgruppe
Die Mitglieder der Fachgruppe sind gehalten, dieses Selbstverständnis gemäß den Entwicklungen des Fachs und der Wirklichkeit entsprechend in regelmäßigen Abständen – etwa im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung – zu aktualisieren. Vorschläge für Änderungen und Ergänzungen sollen der Mitgliederversammlung zur Diskussion vorgelegt werden oder im Rahmen der Email-Liste diskutiert werden. Für eine Änderung des Selbstverständnisses genügt eine einfache Mehrheit der Fachgruppenmitglieder.
Satzung der FG Kommunikation & Politik
§ 1 Name
Die Fachgruppe führt die Bezeichnung "Fachgruppe Kommunikation und Politik in der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft".
§ 2 Aufgaben
Die Fachgruppe verfolgt ihre Ziele im Rahmen der Satzung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK). Dies sind insbesondere Dokumentation und Information über wissenschaftliche Aktivitäten im Bereich der politischen Kommunikation und der Kommunikationspolitik, Ausrichtung von Fachtagungen, Förderung einschlägiger Forschung, Förderung internationaler Zusammenarbeit sowie Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
§ 3 Fachgruppenmitgliedschaft
(1) Die Mitglieder der Fachgruppe müssen Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sein. Sie erklären ihre Zugehörigkeit zur Fachgruppe durch eine entsprechende schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand der DGPuK.
(2) Die Mitgliedschaft in der Fachgruppe wird beendet durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand der DGPuK. Die Mitgliedschaft in der DGPuK bleibt davon unberührt.
§ 4 Fachgruppenleitung
(1) Die Aktivitäten der Fachgruppe werden durch die Fachgruppenleitung koordiniert, die sich aus dem Sprecher/der Sprecherin und einem Stellvertreter/einer Stellvertreterin zusammensetzt. Die unmittelbare Wiederwahl der Sprecherin/des Sprechers sowie der Stellvertreterin/des Stellvertreters ist nur einmal möglich.
(2) Die Amtszeit der Fachgruppenleitung endet mit der Wahl einer neuen Fachgruppenleitung. Dazu hat die Fachgruppenleitung zwei Jahre nach Beginn ihrer Amtszeit eine Fachgruppenversammlung einzuberufen, deren Tagesordnung die Wahl einer neuen Fachgruppenleitung vorsieht.
(3) Scheidet ein Mitglied der Fachgruppenleitung während der Amtszeit aus, so muss innerhalb eines vertretbaren Zeitrahmens ein neues Mitglied gewählt werden, das dann bis zum Ende der regulären Amtszeit der Fachgruppenleitung im Amt bleibt.
(4) Die Fachgruppenleitung berichtet der Mitgliederversammlung der DGPuK über die Arbeit der Fachgruppe.
§ 5 Fachgruppenversammlung
(1) Die Fachgruppenversammlung wird mindestens alle zwei Jahre von der Fachgruppenleitung einberufen.
(2) Zu Fachgruppenversammlungen wird unter Beifügung einer Tagesordnung mit einer Frist von mindestens drei Wochen schriftlich eingeladen.
(3) Versammlungsmodus und Wahlmodus richten sich nach den Regelungen in §7 der Satzung der DGPuK.
(4) Über die Beschlüsse und Wahlen auf Fachgruppenversammlungen ist eine Niederschrift zu verfassen. Die Protokolle werden dem Vorstand der DGPuK zugeleitet.
§ 6 Änderung der Ordnung
Die Änderung der Ordnung kann mit Zweidrittelmehrheit auf einer Fachgruppenversammlung beschlossen werden, an der mindestens 20 Prozent aller Mitglieder teilnehmen. Die Änderung bedarf der Zustimmung durch den Vorstand der DGPuK.
Publikationen der FG Kommunikation & Politik
Hier finden Sie eine Übersicht der Publikationen, die aus den Jahrestagungen oder der sonstigen Arbeit unserer Fachgruppe hervorgegangen sind.
In Vorbereitung
Dan, V., Rußmann, U., Schulz, A., & Müller, P. (Hrsg., in Vorb. für 2026). Communication in Election Campaigns: Staggering Changes or Same Old, Same Old? Special Issue of Media and Communication. Alle Infos zur Einreichung unter: https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/pages/view/nextissues#ElectionCampaigns
F. Oehmer-Pedrazzi, & J. Haßler (Hrsg., in Vorb.). Schlüsselwerke der politischen Kommunikation. Springer VS.
F. Oehmer-Pedrazzi, & S. Pedrazzi (Hrsg., geplant für Oktober 2025). Politik Multimedial. Special Issue von Studies in Communication Sciences (SComS).
Bereits erschienen
Nuernbergk, C., Haßler, J., Schützeneder, J., & Schumacher, N. F. (Hrsg., 2024), Politischer Journalismus: Konstellationen – Muster – Dynamiken. Nomos. https://doi.org/10.5771/9783748939702
Engelmann, I., Legrand, M., & Marzinkowski, H. (Hrsg., 2019). Politische Partizipation im Medienwandel (Digital Communication Research, Band 6). https://doi.org/10.17174/DCR.V6.0
Henn, P., & Frieß, D. (Hrsg., 2016). Politische Online-Kommunikation: Voraussetzungen und Folgen des strukturellen Wandels der politischen Kommunikation (Digital Communication Research, Band 3). https://doi.org/10.17174/DCR.V3.0
Emmer, M., & Strippel, C. (Hrsg., 2015). Kommunikationspolitik für die digitale Gesellschaft (Digital Communication Research, Band 1). https://doi.org/10.17174/dcr.v1.0
Marcinkowski, F. (Hrsg., 2014). Framing als politischer Prozess. Beiträge zum Deutungskampf in der politischen Kommunikation (Politische Kommunikation und demokratische Öffentlichkeit, Band 6). Nomos.
Tenscher, J. (Hrsg., 2013). Politische Kommunikation im Kleinen. SC|M - Studies in Communication and Media, 2(3) (Sonderheft). https://doi.org/10.5771/2192-4007-2013-3
Brosda, C., Langkau, T., & Schicha, C. (Hrsg., 2008). Ethische und normative Dimensionen der politischen Kommunikation. Zeitschrift für Kommunikationsökologie und Medienethik, 10(1) (Sonderheft). https://netzwerk-medienethik.de/wp-content/uploads/2012/01/ZfKM_2008.pdf
Pfetsch, B., & Adam, S. (Hrsg., 2008). Massenmedien als politische Akteure. Konzepte und Analysen. VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90843-4
Sarcinelli, U. & Tenscher, J. (Hrsg., 2008). Politikherstellung und Politikdarstellung: Beiträge zur politischen Kommunikation. Halem.
Donges, P. (Hrsg., 2007). Von der Medienpolitik zur Media Governance? Halem.
Eilders, C., & Hagen, L. (Hrsg., 2005). Krieg als mediatisiertes Ereignis. Medien & Kommunikationswissenschaft, 53(2-3) (Sonderheft). https://doi.org/10.5771/1615-634X-2005-2-3
Gellner, W., & Strohmeier, G. (Hrsg., 2003). Repräsentation und Präsentation in der Mediengesellschaft. Nomos.
Hagen, L. (Hrsg., 2003). Europäische Union und mediale Öffentlichkeit. Theoretische Perspektiven und Befunde zur Rolle der Medien im europäischen Einigungsprozess. Halem.
Schatz, H., Rössler, P., Nieland, J.-U. (Hrsg., 2002). Politische Akteure in der Mediendemokratie. Politiker in den Fesseln der Medien? Westdeutscher Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-85133-8
Schatz, H., Holtz-Bacha, C., & Nieland, J.-U. (Hrsg., 2000). Migranten und Medien. Neue Herausforderungen an die Integrationsfunktion von Presse und Rundfunk. Westdeutscher Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-07794-7
Donges, P., Jarren, O., & Schatz, H. (Hrsg., 1999). Globalisierung der Medien? Medienpolitik in der Informationsgesellschaft. Westdeutscher Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-83329-7
Schatz, H., Jarren, O., & Knaup, B. (Hrsg., 1997): Machtkonzentration in der Multimediagesellschaft? Beiträge zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von politischer und medialer Macht. Westdeutscher Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-87303-3
Jarren, O., Schatz, H., & Weßler, H. (Hrsg., 1996). Medien und politischer Prozeß. Politische Öffentlichkeit und massenmediale Politikvermittlung im Wandel. Westdeutscher Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-91675-4
Jarren, O., Knaup, B., & Schatz, H. (Hrsg., 1995). Rundfunk im politischen Kommunikationsprozeß: Jahrbuch 1995 der Arbeitskreise „Politik und Kommunikation“ der DVPW und der DGPuK. Lit.
Holgersson, S., Jarren, O., & Schatz, H. (Hrsg., 1994). Dualer Rundfunk in Deutschland. Beiträge zu einer Theorie der Rundfunkentwicklung. Jahrbuch 1994 der Arbeitskreise „Politik und Kommunikation” der DVPW und der DGPuK. Lit.
Jarren, O., Marcinkowski, F., & Schatz, H. (Hrsg., 1993). Landesmedienanstalten – Steuerung der Rundfunkentwicklung? Jahrbuch 1993 der Arbeitskreise „Politik und Kommunikation” der DVPW und der DGPuK. Lit.
Jahrestagungen der FG Kommunikation & Politik
Kommende Jahrestagung
Unsere nächste Jahrestagung findet vom 4. bis 6. Februar 2026 in Hamburg zum Thema "Demokratische Resilienz als Aufgabe für die politische Kommunikation in einer instabilen Welt" statt. Organisiert wird die Tagung von Katharina Kleinen-von Königslöw, Judith Möller & Lisa Merten. Neben Einreichungen zum Tagungsthema wird es auch wieder die Möglichkeit zur Einreichung thematisch offener Beiträge geben. Der Call for Papers wird zeitnah veröffentlicht.
NapoKo-Kolloquium & FG-Retreat
Traditionell wird unser Nachwuchsnetzwerk (NapoKo) im Vorfeld der Tagung ein Kolloquium für Promovierende abhalten. Zudem findet auch in Hamburg am letzten Nachmittag der Tagung das Retreat der Fachgruppe Politik & Kommunikation statt, in dessen Rahmen interessierte FG-Mitglieder ein Projekt aus dem Bereich Wissenstransfer bearbeiten. Nähere Infos zu beiden Veranstaltungen folgen.
Frühere Jahrestagungen
Eine Übersicht der bisherigen Tagungen unserer Fachgruppe finden sie hier:
| Datum | Tagungsort | Tagungsthema | Ausrichter:innen |
| 26. bis 28. Februar 2025 | Innsbruck | Wahlkampfkommunikation: (Kaum) Veränderungen im digitalen Zeitalter? | Viorela Dan & Uta Rußmann |
| 7. bis 9. Februar 2024 | Bern | «Politik multimedial»: Kanäle, Inhalte und Wirkungen politischer Kommunikation in (Bewegt)Bild, Ton und Text | Franziska Oehmer-Pedrazzi |
| 28. bis 30. Juni 2023 | Düsseldorf | KI | Konflikte | Konventionen: Aktuelle Herausforderungen für die Politische Kommunikationsforschung | Dennis Frieß, Katharina Gerl, Marco Lünich & Carina Weinmann |
| 29. bis 30. September 2022 | Trier | Politischer Journalismus: Konstellationen – Muster – Dynamiken (gemeinsame Tagung mit der DGPuK-Fachgruppe Journalistik/Journalismusforschung) | Christian Nuernbergk, Peter Maurer & Nina Fabiola Schumacher |
| 12. Februar 2021 | Berlin (hybrid) | Meinungsbildung und Meinungsmacht in dissonanten Öffentlichkeiten | Ulrike Klinger, Christoph Neuberger & Thorsten Thiel |
| 5. bis 7. Februar 2020 | Mainz | Desinformation, Populismus, "Lügenpresse": Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der politischen Kommunikation | Pablo Jost, Simon Kruschinski, Michael Sülflow & Marcus Maurer |
| 7. bis 9. Februar 2019 | Duisburg | Die digitalisierte Demokratie – Politik und Kommunikation zwischen Daten, Netzwerken und Algorithmen | Isabelle Borucki & Dennis Michels |
| 8. bis 10. Februar 2018 | Fribourg | Politische Kommunikation in Krisen und über Krisen | Julia Metag & Caroline Dalmus |
| 16. bis 18. Februar 2017 | Jena | Disliken, diskutieren, demonstrieren – Politische Partizipation im (Medien-)Wandel | Ines Engelmann & Marie Legrand |
| 11. bis 13. Februar 2016 | München | Mehr als Wutbürger, Shitstorms und Lügenpresse? Emotionen in der politischen Kommunikation | Carsten Reinemann & Anne Bartsch |
| 19. bis 21. Februar 2015 | Düsseldorf | Politische Online-Kommunikation: Voraussetzungen, Facetten und Folgen des strukturellen Wandels politischer Kommunikation | Gerhard Vowe & Philipp Henn |
| 6. bis 8. Februar 2014 | Berlin | Kommunikationspolitik und Medienregulierung in der digitalen Gesellschaft | Martin Emmer & Christian Strippel |
| 7. bis 9. Februar 2013 | Wien | Politische Kommunikation in regionalen und lokalen Kontexten | Jens Tenscher |
| 9. bis 11. Februar 2012 | Zürich | Intermediäre Akteure im Wandel. Parteien, Verbände, Interessengruppen und soziale Bewegungen vor neuen kommunikativen Herausforderungen | Otfried Jarren & Franziska Oehmer |
| 10. bis 12. Februar 2011 | Münster | Framing als politischer Prozess | Frank Marcinkowski, Julia Metag & André Donk |
| 11. bis 13. Februar 2010 | Mannheim | Medien und internationale Beziehungen | Hartmut Wessler, Nicole Landeck & Eike Mark Rinke |
| 12. bis 14. Februar 2009 | Düsseldorf | Expertise - Entscheidung – Öffentlichkeit. Politikberatung unter dem Kommunikationsaspek | Gerhard Vowe & Stephanie Opitz |
| 14. bis 15. Februar 2008 | München | Ethische und normative Dimensionen der politischen Kommunikation (gemeinsame Tagung mit der DGPuK-Fachgruppe Kommunikations- und Medienethik) | Rüdiger Funiok |
| 15. bis 17. Februar 2007 | Landau | Politikherstellung und Politikdarstellung | Ulrich Sarcinelli & Jens Tenscher |
| 16. bis 18. Februar 2006 | Zürich | Von der Medienpolitik zur Media Governance? Neue Problemstellungen, Ansätze und Formen der Regulierung öffentlicher Kommunikation | Patrick Donges |
| 10. bis 12. Februar 2005 | Stuttgart-Hohenheim | Medien als Akteure im politischen Prozess | Barbara Pfetsch |
| 13. bis 14. Februar 2004 | Hamburg | Krieg als mediatisiertes Ereignis | Christiane Eilders |
| 6. bis 8. Februar 2003 | Passau | Repräsentation und Präsentation in der Mediengesellschaft | Winand Gellner & Gerd Strohmeier |
| 7. bis 9. Februar 2002 | Nürnberg | Europäische Union und europäische Öffentlichkeit | Lutz Hagen |
| 8. bis 10. Februar 2001 | Erfurt | Politische Akteure in der Mediendemokratie: Politiker, Parteien und Verbände vor neuen Anforderungen der politischen Kommunikation | Patrick Rössler |
| 18. bis 19. Februar 2000 | Wesseling | Politische Kommunikation im internationalen Vergleich | |
| 1999 | Duisburg | MigrantInnen und Medien. Neue Herausforderungen an die Integrationsfunktion von Presse und Rundfunk | Heribert Schatz & Jörg-Uwe Nieland |
| 13. bis 14. Februar 1998 | Hamburg | Medienpolitik in der ‘globalen Informationsgesellschaft’ | |
| 1996 | Berlin | Politische Macht und Medienmacht | |
| 1995 | Lauenburg | Medien und politischer Prozess |
Protokolle der Mitgliederversammlungen der FG Kommunikation & Politik
Hier finden Sie die neuesten Protokolle der Mitgliederversammlungen unserer Fachgruppe als PDF-Dateien zum Herunterladen.
Downloads
- Protokoll der Mitgliederversammlung am 27. Februar 2025 in Innsbruck
- Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. März 2024 in Erfurt
- Protokoll der Mitgliederversammlung am 8. Februar 2024 in Bern
- Protokoll der Mitgliederversammlung am 29. Juni 2023 in Düsseldorf
- Protokoll der Mitgliederversammlung am 19. Mai 2023 in Bremen
Downloads
Selbstverständnis der FG Kommunikation & Politik
Die Fachgruppe Kommunikation und Politik beschäftigt sich mit zwei Grundfragen: Wie beeinflusst Kommunikation in ihren verschiedenen Formen die Strukturen, Prozesse, Akteure und Inhalte der Politik? Und umgekehrt: Welchen Einfluss hat die Politik auf die Strukturen, Prozesse, Akteure und Inhalte von Kommunikation?
Antworten auf diese Fragen suchen die Mitglieder der Fachgruppe aus unterschiedlichen Perspektiven heraus: der politischen Kommunikation, der Medien- und Kommunikationspolitik, der Mediensystemanalyse und der Öffentlichkeitssoziologie.
Ihren Themen an der Schnittstelle von Kommunikation und Politik widmet sich die Fachgruppe grundsätzlich aus einer interdisziplinären Perspektive heraus. Seit ihrer Gründung 1991 fanden die Jahrestagungen der Fachgruppe jeweils gemeinsam mit dem Arbeitskreis Politik und Kommunikation der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) statt. In den letzten Jahren kooperiert die Fachgruppe auch mit der Fachgruppe Politische Kommunikation der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM). Die Fachgruppe ist offen für verschiedene theoretische wie empirische Zugänge zu diesem interessanten Forschungsfeld und für den Austausch mit der Praxis.
In der Nachwuchsförderung arbeitet die Fachgruppe seit 2004 eng mit dem Nachwuchsnetzwerk politische Kommunikation (NapoKo) zusammen, das sich an Studierende sowie junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wendet, die sich für Fragen der politischen Kommunikation interessieren und nach Möglichkeiten des interdisziplinären Austausches mit Gleichgesinnten suchen.
Publikationen der Fachgruppe
Wirth, Werner & Lauf, Edmund (Hrsg.) (2001): Inhaltsanalyse: Perspektiven, Probleme, Potentiale. Köln: Herbert von Halem Verlag.

Der Sammelband “Inhaltsanalyse: Perspektiven, Probleme, Potentiale” ist im Juli 2001 im Herbert von Halem Verlagerschienen.
Der Band eröffnet neue Perspektiven für die zentrale Methode der Medien- und Kommunikationswissenschaft: die Inhaltsanalyse. Er ist damit für Studierende, Lehrende und Forschende, die sich – auch fachübergreifend – eingehender mit den Potentialen der Inhaltsanalyse beschäftigen wollen, eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zu den bekannten Einführungswerken. In fünf Kapiteln mit insgesamt 21 Beiträgen werden sowohl praxisnahe als auch methodentheoretische Aspekte der Inhaltsanalyse dargestellt. Behandelt werden Probleme der Konzeptualisierung spezifischer Konstrukte, der Standardisierung, der Kategorienbildung, des Codierprozesses, neuer Instrumente und Anwendungen, der computergestützten Inhaltsanalyse und der Lehre. Erklärtes Ziel des Bandes ist es, die in den letzten Jahren nahezu zum Erliegen gekommene Reflexion über die Methode der Inhaltsanalyse neu zu beleben. Daß dies im Ansatz schon gelungen ist, belegt die seltene Breite der in diesem Band versammelten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen: Fast alle großen deutschen kommunikationswissenschaftlichen Institute sind durch Autoren vertreten.
Die Herausgeber
Dr. Werner Wirth ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik und Theater Hannover.
Dr. Edmund Lauf ist Postdoctoral Research Fellow in Communication Science der Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) an der Universiteit van Amsterdam.
Publikationen der Fachgruppe
Wirth, Werner; Lauf, Edmund & Fahr, Andreas (Hrsg.) (2004): Forschungslogik und –design in der empirischen Kommunikationswissenschaft. Band 1: Einführung, Problematisierungen und Aspekte der Methodenlogik aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive. Köln: Herbert von Halem Verlag.
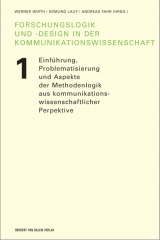
In der Kommunikationswissenschaft haben sich vielfältige Methoden und Designs der Sozialwissenschaften etabliert, nicht immer jedoch ist ihre spezifische Anwendbarkeit geklärt. Der Band zeigt auf, welche besonderen forschungspraktischen und methodentheoretischen Bedingungen in kommunikationswissenschaftlichen Experimenten, Panel-, Pfad- oder Zeitreihenanalysen beachtet werden müssen und wie diese Verfahren optimal an die Fachperspektive angepasst werden können. Der Band wendet sich an Studierende sowie an Personen aus Praxis und Wissenschaft des Fachs Kommunikationswissenschaft, die sich für Fragen der Forschungslogik und der Beweisführung in der empirischen Forschung interessieren.
Publikationen der Fachgruppe
Gehrau, Volker; Fretwurst, Benjamin; Krause, Birgit & Daschmann, Gregor (Hrsg.) (2005): Auswahlverfahren in der Kommunikationswissenschaft. Köln: Herbert von Halem Verlag.

In der Kommunikationswissenschaft werden Auswahlverfahren und ihre methodischen Probleme kaum diskutiert. Das verwundert zum einen, weil die Güte empirischer Daten immer auch vom Auswahlverfahren bestimmt wird und zum anderen weil sich bei kommunikationswissenschaftlichen Studien, insbesondere bei Inhaltsanalysen, Probleme ergeben, die nicht mit den üblichen Ansätzen für Zufallsstichproben gelöst werden können. Deshalb widmet sich der gesamte Band unterschiedlichen Aspekten von typischen Auswahlverfahren der Kommunikationswissenschaft.
Die ersten drei Beiträge befassen sich mit grundsätzlichen Fragen: Welche Auswahlverfahren werden in der Kommunikationswissenschaft angewandt? Wie werden sie dokumentiert? Welche Besonderheiten ergeben sich bei qualitativen Untersuchungsanlagen? Im zweiten Teil geht es um die speziellen Probleme bei Inhaltsanalysen. Zunächst wird die Güte verschiedener künstlicher Zeitverläufe theoretisch diskutiert und empirisch untersucht. Dann geht es um natürliche Wochen für Fernsehprogrammanalysen und anschlie§end um den Umgang mit herausragenden Ereignissen während der Erhebungszeit. Abschließend geht es um publizistische Stichproben für Zeitungen sowie vergleichende Stichproben von Internetseiten. Der letzte Abschnitt des Buches behandelt Auswahlprobleme bei Befragungen. Zunächst werden Auswahlpläne für repräsentative Journalistenbefragungen behandelt und dann Probleme der Geburtstagsmethode bei Telefonumfragen. Den Abschluss bilden praktische Fragen zu Auswirkungen von Face-to-face- versus Telefonbefragungen auf die Stichprobe sowie unterschiedliche Rekrutierungsverfahren bei Online-Befragungen.
Downloads
Publikationen der Fachgruppe
Wirth, Werner; Fahr, Andreas & Lauf, Edmund (Hrsg.) (in Vorbereitung): Forschungslogik und –design in der empirischen Kommunikationswissenschaft. Band 2: Anwendungsfelder in der Kommunikationswissenschaft. Köln: Herbert von Halem Verlag.
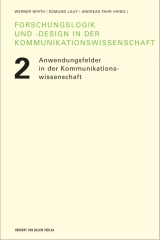
In der Kommunikationswissenschaft haben sich eine Vielzahl von Forschungstraditionen etabliert, eine breite Vielfalt von Methoden und Designs kommen dabei zum Einsatz. Die Kehrseite des rasanten Wachstums zeigt sich, wenn in Forschungsüberblicken wiederholt die heterogene Befundlage beklagt wird. Häufig sind vermeidbare methodische Defizite für die Heterogenität und Widersprüchlichkeit der Befunde mitverantwortlich: Methoden und Designs sind noch zu wenig auf die spezifischen kommunikationswissenschaftlichen Fragestellungen und Forschungsfelder abgestimmt bzw. es wird nicht immer hinreichend geklärt, welchen spezifischen Erkenntnisgewinn die einzelnen Methoden in einem Forschungsgebiet beisteuern können. Vor allem auf der Interpretationsebene werden Ergebnisse nicht selten überstrapaziert und Forschungsfragen beantwortet, für die das genutzte Design oder die verwendete Methode nur sehr eingeschränkt geeignet sind. Möglicherweise ebenso problematisch ist es, wenn methodische Paradigmen unreflektiert aus ihrem psychologischen und/oder soziologischen Kontext entnommen und in die Kommunikationswissenschaft übertragen werden.
Erklärtes Ziel der zweibändigen Publikation ist es deshalb, die empirische Beweis- und Argumentationsstruktur bestimmter Methoden, Designs und/oder Forschungsansätze aus einer dezidiert kommunikationswissenschaftlichen Perspektive heraus zu analysieren, zu systematisieren und so eine foschungslogisch korrekte Fachperspektive einzubringen. Daraus leiten sich zwei große Blöcke für den Themenband ab, denen ein allgemeinerer Einführungsblock vorangestellt wird.
Band 2 – Anwendungsfelder in der Kommunikationswissenschaft:
Der dritte Teil geht nicht mehr von einzelnen Methoden, sondern von konkreten kommunikationswissenschaftlichen Anwendungsfeldern aus, die in der Regel mit einem Bündel an Designs und Methoden erforscht werden. Die Beiträge in diesem Abschnitt beschäftigen sich aus der Sicht eines Forschungsansatzes oder -bereichs problematisierend und systematisierend mit der Vielfalt der jeweils eingesetzten Methoden und Designs und den daraus sich ergebenden Schlussfolgerungen für das Forschungsgebiet. Ein Ergebnis solcher Bemühungen könnten durchaus (müssen aber nicht) Ansätze zur Standardisierung eines Forschungsgebietes sein. Der Konzeptband möchte auf die Synergieeffekte hinweisen, die die Vielfalt kommunikationswissenschaftlicher Methoden für die Forschung bieten kann, wenn deren Eigenheiten reflektiert und sinnvoll verknüpft werden. Der Band richtet sich vor allem an Studierende, Lehrende und Forschende in der Kommunikations- und Medienwissenschaft, aber auch an alle Interessierte, die sich nicht mit vorschnellen Urteilen über einzelne Methoden oder Forschungsbefunde zufrieden geben, sondern sich eingehender mit den Möglichkeiten und Bedingungen kommunikationswissenschaftlichen Forschens beschäftigen wollen.
Die Autoren des Bandes sind: Helena Bilandzic, Hans-Bernd Brosius, Andreas Fahr, Tilo Hartmann, Hans Mathias Kepplinger, Edmund Lauf, Teresa Naab, Oliver Quiring, Patrick Rössler, Constanze Rossmann, Helmut Scherer, Bertram Scheufele, Holger Schramm, Annekaryn Tiele, Jeffrey Wimmer, Werner Wirth und Jens Wolling.

